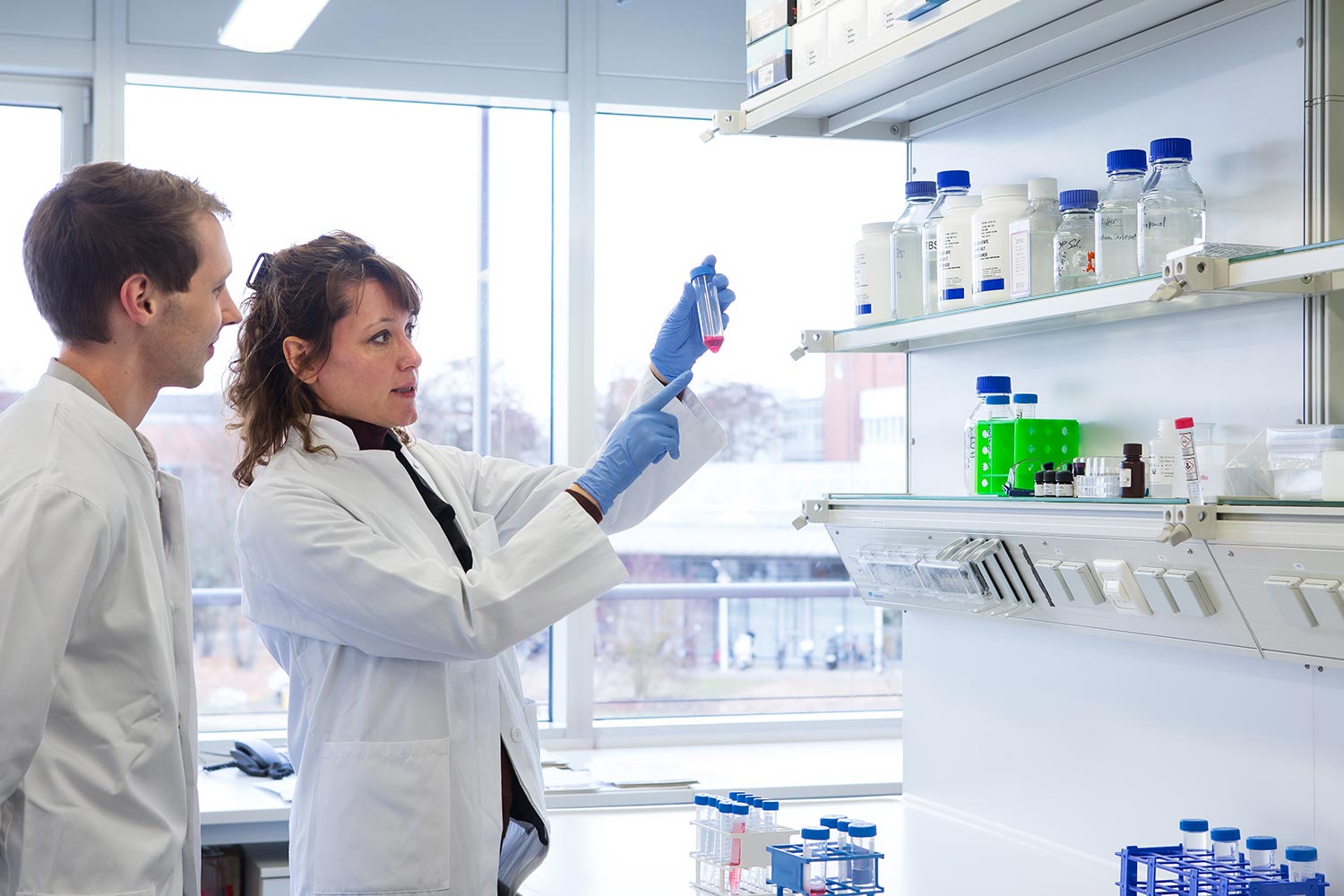
SFB Transregio 221|Standortübergreifende Projektübersicht
Teilprojekt B01
Kurzbeschreibung des Teilprojekts B01
Calcineurin-Inhibitoren blockieren eine NFAT-Aktivierung und schützen Patienten nach allogener HSZT vor der Transplantat-gegen-Wirt-Reaktion. Andererseits verursachen sie schwere Nebenwirkungen und beeinträchtigen den wertvollen Transplantat-gegen-Leukämie-Effekt. Dagegen ist bei NFAT-Defizienz im Mausmodell der Transplantat-gegen-Leukämie-Effekt erhalten obwohl Mäuse weiterhin vor der Transplantat-gegen-Wirt-Reaktion geschützt sind. Deshalb wollen wir neue NFAT-Inhibitoren in vitro sowie auf künstlicher humaner Haut und in Mausmodellen evaluieren und NFAT-Familienmitglieder über CRISPR/Cas9 vor einem Zelltransfer deletieren.
Ausgewählte Publikationen
Bülow, S. et al. (2024) ‘Bactericidal/permeability-increasing protein instructs dendritic cells to elicit Th22 cell response’, Cell Reports, 43(3), p. 113929. Available at: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2024.113929.
Xiao, Y. et al. (2021) ‘Lack of NFATc1 SUMOylation prevents autoimmunity and alloreactivity’, Journal of Experimental Medicine, 218(1), p. e20181853. Available at: https://doi.org/10.1084/jem.20181853. Data available in GSE119313
Kontakt zur Projektleitung
- PD Dr. rer. nat Friederike Berberich-Siebelt
Universität Würzburg
Institut für Pathologie
Josef-Schneider-Straße 2
97080 Würzburg
T: 0931 31-81208
path230(at)mail.uni-wuerzburg.de
- PD Dr. med. Silvia Spörl
University Hospital Erlangen
Department of Medicine 5
Ulmenweg 18
91054 Erlangen
T: 09131 8545021
silvia.spoerl(at)uk-erlangen.de
Teilprojekt B02
Kurzbeschreibung des Teilprojekts B02
In Vorarbeiten zeigten wir, dass sowohl die Aktivierung des TNFR2 als auch die Blockade des Fn14-Moleküls durch unterschiedliche Wirkmechanismen die GvHD inhibiert ohne den GvL-Effekt zu beeinträchtigen. Nun soll geklärt werden, ob eine gleichzeitige Adressierung der beiden Rezeptoren einen additiven oder synergistischen therapeutischen Effekt hat. Um den TNFR2 auf Tregs zu adressieren, werden anti-human TNFR2 Antikörper mit Fcγ-Rezeptor unabhängiger agonistischer Aktivität sowie verschiedene IL-2R bindende TNFR2-Agonisten entwickelt. Diese neuen Reagenzien werden dann in vitro und in humanen TNFR2 knockin Mäusen in vivo evaluiert.
Ausgewählte Publikationen
Lubrano Di Ricco, M. et al. (2020) ‘Tumor necrosis factor receptor family costimulation increases regulatory T‐cell activation and function via NF‐κB’, European Journal of Immunology, 50(7), pp. 972–985. Available at: https://doi.org/10.1002/eji.201948393. Data available in GSE146135
Siegmund, D. and Wajant, H. (2023) ‘TNF and TNF receptors as therapeutic targets for rheumatic diseases and beyond’, Nature Reviews Rheumatology, 19(9), pp. 576–591. Available at: https://doi.org/10.1038/s41584-023-01002-7.
Kontakt zur Projektleitung
- Prof. Dr. rer. nat. Harald Wajant
Universitätsklinikum Würzburg
Medizinische Klinik und Poliklinik II
Abteilung für Molekulare Innere Medizin
Röntgenring 11
97070 Würzburg
T: 0931 201-71000
harald.wajant@mail-uni-wuerzburg.de
Teilprojekt B03
Kurzbeschreibung des Teilprojekts B03
CSF2+ T-Zellen wurden kürzlich als wichtige Vermittler der Gewebeentzündung bei Autoimmunprozessen beschrieben. Die Rolle innerhalb der GvHD Pathogenese wurde bisher noch nicht untersucht. Unsere Ergebnisse zeigen, dass CSF2+ Spender-T-Zellen zur Manifestation einer Darm-GvHD sehr wesentlich beitragen. Im Zentrum des Forschungsvorhabens stehen daher molekulare und funktionelle Analysen der die Entwicklung CSF2+ Spender-T-Zellen regulierenden, T-Zell-extrinsischen und -intrinsischen Signale. Zudem werden die Eigenschaften und Effektormechanismen von CSF2+ Spender-T-Zellen in der Immunpathogenese der GvHD identifiziert.
Ausgewählte Publikationen
Ausgewählte Publikationen
Buchele, V. et al. (2018) ‘Targeting Inflammatory T Helper Cells via Retinoic Acid-Related Orphan Receptor Gamma t Is Ineffective to Prevent Allo-Response-Driven Colitis’, Frontiers in Immunology, 9, p. 1138. Available at: https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.01138.
Hippe, K. et al. (2023) ‘Round-Robin test for the histological diagnosis of acute colonic Graft-versus-Host disease validating established histological criteria and grading systems’, Virchows Archiv, 483(1), pp. 47–58. Available at: https://doi.org/10.1007/s00428-023-03544-3.
Kontakt zur Projektleitung
- Prof. Dr. med. Kai Hildner
Universitätsklinikum Erlangen
Medizinische Klinik 1
Ulmenweg 18
91054 Erlangen
T: 09131 85-35000 o. 85-45173
kai.hildner(at)uk-erlangen.de
Teilprojekt B04
Kurzbeschreibung des Teilprojekts B04
Metabolische Veränderungen spielen eine zentrale Rolle in der Pathogenese entzündlicher und fibrotischer Erkrankungen.Wir konnten in unseren Vorarbeiten zeigen, dass die Expression von ALDH3A2 in der Haut von cGvHD Patienten TGFß-abhängig dereguliert ist. Der Knockdown von ALDH3A2 in Fibroblasten hemmt die Fibroblastenaktivierung und die Kollegensynthese, während eine Überexpressiongegenteilige Effekte induziert. Im Mausmodell der cGvHD hemmt der Knockdown von ALDH3A2 die Leukozyteninfiltration und den fibrotischen Umbau der Haut. Wir planen eine weiterführende Analyse der Effekte von ALDH3A2 auf die Leukozyten- und Fibroblastenaktivierunginkl. Analyse der durch ALDH3A2 regulierten Botenstoffe und intrazellulären Signalkaskaden.
Ausgewählte Publikationen
Treutlein, C. et al. (2023) ‘Assessment of myocardial fibrosis in patients with systemic sclerosis using [68Ga]Ga-FAPI-04-PET-CT’, European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 50(6), pp. 1629–1635. Available at: https://doi.org/10.1007/s00259-022-06081-4.
Schmidt, A. et al. (2022) ‘Deciphering Pro-angiogenic Transcription Factor Profiles in Hypoxic Human Endothelial Cells by Combined Bioinformatics and in vitro Modeling’, Frontiers in Cardiovascular Medicine, 9, p. 877450. Available at: https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.877450. Data available in GSE70335
Kontakt zur Projektleitung
- Prof. Dr. med. Jörg Distler
Universitätsklinikum Erlangen
Medizinische Klinik 3
Ulmenweg 18
91054 Erlangen
T: 09131 85-43008
joerg.distler(at)uk-erlangen.de
- PD Dr. med. Regina Jischin, PhD
Universitätsklinikum Erlangen
Medizinische Klinik 5
Ulmenweg 18
91054 Erlangen
T: 09131 8543113
regina.jitschin(at)uk-erlangen.de
Teilprojekt B07
Kurzbeschreibung des Teilprojekts B07
In früheren Arbeiten konnten wir nachweisen, dass der adoptive Transfer von CD4+CD25+Foxp3+ regulatorischen Spender-T-Zellen (Treg) im Mausmodell vor der letalen GvHD schützt. Kürzlich konnten wir zeigen, dass Spender-Treg bei akuter GvHD auch therapeutisch wirksam sind. Ziel dieses Projektes ist es, die Bedingungen für die therapeutische Wirksamkeit von Treg zu klären, wofür ihr Migrationsverhalten untersucht wird, ihr T-Zell-Rezeptorrepertoire in GvHD-Zielorganen sowie ihr funktioneller Status. Schließlich soll geprüft werden, ob die Wirksamkeit der Zellen durch Überexpression von alloreaktiven T-Zell-Rezeptoren oder Migrationsfaktoren gesteigert werden kann.
Ausgewählte Publikationen
Ausgewählte Publikationen
Delacher, M. et al. (2024) ‘The effector program of human CD8 T cells supports tissue remodeling’, Journal of Experimental Medicine, 221(2), p. e20230488. Available at: https://doi.org/10.1084/jem.20230488. Data available in GSE223989
Dittmar, D.J. et al. (2024) ‘Donor regulatory T cells rapidly adapt to recipient tissues to control murine acute graft-versus-host disease’, Nature Communications, 15(1), p. 3224. Available at: https://doi.org/10.1038/s41467-024-47575-z. Data available in GSE223800
Kontakt zur Projektleitung
- PD Dr. rer. nat. Petra Hoffmann
LIT - Leibniz Institute for Immunotherapy (ehemals RCI)
c/o Universitätsklinikum Regensburg
Franz-Josef-Strauß-Allee 11
93053 Regensburg
T: 0941 944-38492
petra.hoffmann(at)ukr.de
- Prof. Dr. rer. nat. Michael Rehli
Universitätsklinikum Regensburg
Klinik und Poliklinik für Innere Medizin III
Franz-Josef-Strauß-Allee 11
93053 Regensburg
T: 0941 944-38487
michael.rehli(at)ukr.de
- Prof. Dr. med. Matthias Edinger
Universitätsklinikum Regensburg
Klinik und Poliklinik für Innere Medizin III
Franz-Josef-Strauß-Allee 11
93053 Regensburg
T: 0941 944-5582
matthias.edinger(at)ukr.de
Teilprojekt B08
Kurzbeschreibung des Teilprojekts B08
Regulatorische T-Zellen (Treg) können zwei unterschiedliche Funktionen ausüben: Sie sind wichtig für die Aufrechterhaltung von Immuntoleranz und unterstützen Gewebehomöostase durch die Differenzierung in gewebeständige Treg-Zellen. Wir möchten die Gewebereparaturfunktion von gewebeständigen Treg-Zellen nutzen, um die Graft-versus-Host-Erkrankung nach allogener Stammtransplantation zu verhindern oder zu behandeln. In diesem Zusammenhang untersuchen wir im Tiermodel TH2-polarisierte gewebeständige Treg-Zellen, die in vielen Organen vorkommen. Darüber hinaus analysieren wir, ob die Erkenntnisse auf den Menschen übertragbar sind.
Ausgewählte Publikationen
Ausgewählte Publikationen
Delacher, M. et al. (2024) ‘The effector program of human CD8 T cells supports tissue remodeling’, Journal of Experimental Medicine, 221(2), p. e20230488. Available at: https://doi.org/10.1084/jem.20230488. Data available in GSE223989
Bittner, S., Hehlgans, T. and Feuerer, M. (2023) ‘Engineered Treg cells as putative therapeutics against inflammatory diseases and beyond’, Trends in Immunology, 44(6), pp. 468–483. Available at: https://doi.org/10.1016/j.it.2023.04.005.
Kontakt zur Projektleitung
- Prof. Dr. med. Markus Feuerer
LIT - Leibniz Institute for Immunotherapy (ehemals RCI)
c/o Universitätsklinikum Regensburg
Franz-Josef-Strauß-Allee 11
93053 Regensburg
T: 0941 944-38121
markus.feuerer(at)ukr.de
Teilprojekt B09
Kurzbeschreibung des Teilprojekts B09
Basierend auf unseren jüngsten Erkenntnissen über den räumlichen und zeitlichen Verlauf der Graft-versus-Host-Erkrankung konnten wir eine myeloide Zellpopulation identifizieren, welche alloreaktive T-Zellen im Intestinaltrakt reguliert. Mithilfe präklinischer Mausmodelle soll diese Zellpopulation genauer charakterisiert, ihre immunregulatorischen Wirkmechanismen analysiert und ihr therapeutisches Potenzial in der allogenen Stammzelltransplantation untersucht werden.
Ausgewählte Publikationen
Anany, M.A. et al. (2024) ‘Generic design principles for antibody-based tumour necrosis factor (TNF) receptor 2 (TNFR2) agonists with FcγR-independent agonism’, Theranostics, 14(2), pp. 496–509. Available at: https://doi.org/10.7150/thno.84404.
Shaikh, H. et al. (2022) ‘Fibroblastic reticular cells mitigate acute GvHD via MHCII-dependent maintenance of regulatory T cells’, JCI Insight, 7(22), p. e154250. Available at: https://doi.org/10.1172/jci.insight.154250. Data available in GSE168114
Kontakt zur Projektleitung
- Prof. Dr. med. Dr. med. univ. Andreas Beilhack
Universitätsklinikum Würzburg
Medizinische Klinik und Poliklinik II
ZEMM Zentrum für Experimentelle Molekulare Medizin
Zinklesweg 10
97078 Würzburg
T: 0931 201-44040
beilhack_a(at)ukw.de
- Dr. rer. nat. Mercedes Gomez de Agüero
Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Institut für Systemimmunologie
Versbacher Straße 9
97078 Würzburg
T: 0931 80303
mercedes.gomes(at)uni-wuerzburg.de
Teilprojekt B10
Kurzbeschreibung des Teilprojekts B10
Obwohl die Rolle einer Antikörper-vermittelten Schädigung bei der experimentellen chronischen GvHD wiederholt belegt wurde, bleibt die klinische Bedeutung unklar. Innerhalb des Forschungsvorhabens sollen deshalb bei Patienten mit chronischer GvHD beteiligte klonale B-Zell-Subpopulationen und follikuläre T-Helfer-Zellen charakterisiert werden, wofür die Glykosylierung Empfänger-spezifischer Antikörper untersucht wird, die Klonalität infiltrierender B-Zellen sowie das Target und der Mechanismus der Antikörper-vermittelten Schädigung in Zielorganen.
Ausgewählte Publikationen
Winkler, J. et al. (2024) ‘Adoptive transfer of donor B lymphocytes: a phase 1/2a study for patients after allogeneic stem cell transplantation’, Blood Advances, 8(10), pp. 2373–2383. Available at: https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2023012305.
Ferreira-Gomes, M. et al. (2021) ‘SARS-CoV-2 in severe COVID-19 induces a TGF-β-dominated chronic immune response that does not target itself’, Nature Communications, 12(1), p. 1961. Available at: https://doi.org/10.1038/s41467-021-22210-3. Data available in GSE158038
Kontakt zur Projektleitung
- Prof. Dr. rer. nat. Thomas Winkler
FAU Erlangen-Nürnberg
Abteilung Biologie
Nikolaus-Fiebiger-Zentrum für Molekulare Medizin
Glückstraße 6
91054 Erlangen
T: 09131 85-29136
thomas.winkler(at)fau.de
- Dr. med. Julia Winkler
Universitätsklinikum Erlangen
Medizinische Klinik 5
Ulmenweg 18
91054 Erlangen
T: 09131 85-43112
julia.winkler(at)uk-erlangen.de
- Prof. Dr. med. Daniel Wolff
Universitätsklinikum Regensburg
Klinik und Poliklinik für Innere Medizin III
Franz-Josef-Strauß-Allee 11
93053 Regensburg
T: 0941 944-5531
daniel.wolff(at)ukr.de
Teilprojekt B11
Kurzbeschreibung des Teilprojekts B11
Patienten nach allogener HSZT haben ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Die wechselseitige Beeinflussung der GvHD und Atherosklerose werden wir in einem GvHD-Atherosklerose Mausmodell untersuchen, in dem wir die GvHD Aktivität, Plaqueentwicklung und die lokale und systemische Immunantwort analysieren können. In diesem Modell werden wird uns funktionell auf die Rolle von Monozyten/Makrophagen und CD8+ T-Zellen fokussieren. Weiter werden wir den Einfluss immunsuppressiver Medikamente auf die GvHD-vermittelte Atherosklerose untersuchen. Damit wollen wir neue Ansätze identifizieren, die das kardiovaskuläre Risiko nach HSZT reduzieren.
Ausgewählte Publikationen
Ullrich, E., Beilhack, A. and Wolf, D. (2022) ‘Editorial: Novel and Improved Methods for the Prevention and Treatment of Graft-Versus-Host Disease (GVHD)’, Frontiers in Immunology, 13, p. 966389. Available at: https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.966389.
Vargas, J.G. et al. (2022) ‘A TNFR2-Specific TNF Fusion Protein With Improved In Vivo Activity’, Frontiers in Immunology, 13, p. 888274. Available at: https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.888274.
Anany, M.A. et al. (2024) ‘Generic design principles for antibody-based tumour necrosis factor (TNF) receptor 2 (TNFR2) agonists with FcγR-independent agonism’, Theranostics, 14(2), pp. 496–509. Available at: https://doi.org/10.7150/thno.84404.
Kontakt zur Projektleitung
- Prof. Dr. med. Alma Zernecke-Madsen
Universitätsklinikum Würzburg
Institut für Experimentelle Biomedizin II
Josef-Schneider-Straße 2
97080 Würzburg
T: 0931 201-48331
alma.zernecke(at)uni-wuerzburg.de
- Prof. Dr. med. Dr. med. univ. Andreas Beilhack
Universitätsklinikum Würzburg
Medizinische Klinik und Poliklinik II
ZEMM Zentrum für Experimentelle Molekulare Medizin
Zinklesweg 10
97078 Würzburg
T: 0931 201-44040
beilhack_a(at)ukw.de
Teilprojekt B12
Kurzbeschreibung des Teilprojekts B12
In diesem Projekt sollen Mechanismen analysiert werden, die erklären warum hohe Vitamin D3-Spiegel bei allogenen HSZT-Patienten mit einem besseren Überleben korrelieren. Hierzu werden zunächst Effekte von Vitamin D3 auf das Mikrobiom, die Epithel-Funktion und Immunzellen in Zielorganen der GvHD im Mausmodell untersucht. In vitro Analysen sollen direkte Effekte von Vitamin D3 auf Immunzellen nachweisen und werden in Mausmodellen nach Deletion des Vitamin D-Rezeptors bestätigt. Diese Ergebnisse werden anhand von Patientenproben verifiziert und sollen als Basis für eine prospektive Studie zur Vitamin D-Supplementierung von HSZT-Patienten dienen.
Ausgewählte Publikationen
Schreiber, L. et al. (2024) ‘Strain specific differences in vitamin D3 response: impact on gut homeostasis’, Frontiers in Immunology, 15, p. 1347835. Available at: https://doi.org/10.3389/fimmu.2024.1347835.
Hammon, K. et al. (2024) ‘D-2-hydroxyglutarate supports a tolerogenic phenotype with lowered major histocompatibility class II expression in non-malignant dendritic cells and acute myeloid leukemia cells’, Haematologica [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.3324/haematol.2023.283597.
Kontakt zur Projektleitung
- Prof. Dr. rer. nat. Marina Kreutz
Universitätsklinikum Regensburg
Klinik und Poliklinik für Innere Medizin III
Franz-Josef-Strauß-Allee 11
93053 Regensburg
T: 0941 944-5577
marina.kreutz(at)ukr.de
- PD Dr. rer. nat. Heiko Bruns
Universitätsklinikum Erlangen
Medizinische Klinik 5
Ulmenweg 18
91052 Erlangen
T: 09131 85-43163
heiko.bruns(at)uk-erlangen.de
Teilprojekt B13
Kurzbeschreibung des Teilprojekts B13
Untersuchungen zeigten eine hohe Abundanz von Enterokokken bei klinischer Darm-GvHD. Der kau-sale Zusammenhang zwischen Enterokokken und GvHD ist jedoch unklar. Wir werden deshalb Enterokokkenstämme aus Patienten zunächst in epithelialen Kulturen auf ihre Zytotoxizität analy-sieren und dann sowohl apathogene als auch die am stärksten pathogenen Stämme in Maus-modellen der Colitis und GvHD untersuchen. GvHD wird dazu in keimfreien Mäusen oder Antibiotika behandelten Mäusen induziert, die mit diesen Enterokokken rekolonisiert wurden. Langfristig werden die Pathogenitätsfaktoren dieser Stämme durch Sequenzierung und gezielte Mutagenese identifiziert.
Ausgewählte Publikationen
Thiele Orberg, E. et al. (2024) ‘Bacteria and bacteriophage consortia are associated with protective intestinal metabolites in patients receiving stem cell transplantation’, Nature Cancer, 5(1), pp. 187–208. Available at: https://doi.org/10.1038/s43018-023-00669-x.
Jarosch, S. et al. (2023) ‘Multimodal immune cell phenotyping in GI biopsies reveals microbiome-related T cell modulations in human GvHD’, Cell Reports Medicine, 4(7), p. 101125. Available at: https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2023.101125. Data available in GSE234357
Kontakt zur Projektleitung
- PD Dr. med. Daniela Weber
Universitätsklinikum Regensburg
Klinik und Poliklinik für Innere Medizin III
Franz-Josef-Strauß-Allee 11
93053 Regensburg
T: 0941 944-5510
daniela.weber(at)ukr.de
- Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. André Gessner
Universitätsklinikum Regensburg
Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin
Franz-Josef-Strauß-Allee 11
93053 Regensburg
T: 0941 944-6401
andre.gessner(at)ukr.de
- Prof. Dr. med. Ernst Holler
Universitätsklinikum Regensburg
Klinik und Poliklinik für Innere Medizin III
Franz-Josef-Strauß-Allee 11
93053 Regensburg
T: 0941 944-5542
ernst.holler(at)ukr.de






















